Ein Volk sitzt zu Gericht
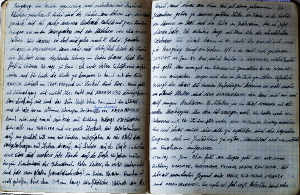 Text: Bernd Hauser
Text: Bernd Hauser
Fotos: Uli Reinhardt
Früher schlichteten die Gacacas, die Grasgerichte, Streitereien um ein verkauftes Kalb oder ein Stück Land. Heute stehen Mörder und Vergewaltiger vor den Laienrichtern. 800 000 Tutsis wurden 1994 im Völkermord von Ruanda abgeschlachtet. 120 000 Hutus warten in den Gefängnissen auf ihre Verhandlung. Normale Gerichte würden dazu an die hundert Jahre benötigen. Insgesamt 12 000 Grasgerichte sollen es in drei oder auch fünf Jahren schaffen. Eine kleine Hoffnung auf Frieden.
An jedem Sonntag tagt das Gericht im Stadtteil Kimisagara von Kigali. Unter Plastikplanen hocken dicht gedrängt 200 Menschen auf Bänken, zu Füßen der Mütter spielen Kinder im Staub. Auf der Straße nebenan knattern Motorräder und hupen Autos. Der Menge zugewandt sitzen neun ältere Frauen und Männer mit Schärpen in den blaugelbgrünen Landesfarben – die Richter.
„Dieser Mann trug ein Gewehr!“, ruft eine Frau und zeigt auf Umwigitije Athanase, ein etwa 35 Jahre alter Mann in weißem Hemd. Seine Stirn liegt in Falten, sein Gesichtsausdruck ist angespannt und leidend, seine Haltung leicht gebeugt. Athanase fühlt sich unwohl. Eine weitere Frau verlangt das Megaphon: „Der Mann war bei der Interahamwe-Miliz, als sie meine Söhne mitnahmen. Am nächsten Tag fanden wir sie tot.“
„Warum hatten Sie ein Gewehr?“
Einer der Richter fragt Athanase: „Waren Sie dabei, als die jungen Männer ermordet wurden?“ Athanase antwortet: „Manche sagen ja, andere sagen nein.“ „Antworten Sie konkret!“ „Das habe ich schon vergangene Woche gesagt! Ich habe sie nicht getötet. Einem von ihnen, der noch nicht tot war, habe ich sogar ein Hemd gegeben, damit er nicht friert.“ „Warum hatten Sie ein Gewehr?“ „Der Chef der Interahamwe-Miliz bat mich, darauf aufzupassen.“ „Warum trugen Sie einen Tarnanzug?“ „Die Interahamwe-Führer sagten: Wer ein Gewehr trägt, braucht eine Uniform. Sie schenkten mir eine. Ich konnte nicht nein sagen. Die Uniform sah gut aus.“
Die Menge lacht leise. Eine Zuhörerin verlangt das Megaphon: „Ich habe gesehen, wie eine Gruppe Männer, darunter Athanase, um sechs leblose Körper herumstand. Einer der Niedergeschlagenen lebte noch. Da sagte einer von Athanases Spießgesellen: ´Hutu-Power wird nicht für ewig sein? Dir werden wir es zeigen!´ Dann schlugen sie ihn tot.“
Ein Raunen geht durch das Gericht. Eine Frau sagt: „Ich bitte Gott, dass er die Wut aus meinem Herzen nimmt. Ich will vergeben, denn ich muss mit den Tätern zusammenleben. Aber sie müssen endlich die Wahrheit sagen!“
Noch eine weitere Zuhörerin will ihre Geschichte zu Protokoll geben, sie klagt einen lokalen Milizführer an. „Ich wartete in meinem Haus darauf, dass sie kommen würden und micht töten. Ich hielt es nicht mehr aus, und ging zum Führer der Interahamwe. Ich flehte ihn um Erbarmen an. Er riss mein Kind zu Boden und vergewaltigte mich.“
Kopfschütteln und mitfühlendes Murmeln. Ein junger Mann erhebt sich. „Mein Name ist Ernest Karangua. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bitte euch, erzählt mir von meinen Eltern! Ich weiß nur ihre Namen, sonst nichts.“ Niemand meldet sich. „Wirklich niemand, der sie kennt?“ Stille. „Dass ich nichts von meiner Familie weiß, das macht mich einsam. Ich muss wissen, wie sie ums Leben gekommen sind und wer es getan hat. Vielleicht habe ich die Täter schon getroffen – auf dem Markt, in einer Bar. Das ist doch unerträglich!“
„Haben Sie Geduld! Wir werden das nächste Mal erneut nach Ihren Eltern fragen“, sagt einer der Richter. „Es ist fünf Uhr, die Sitzung ist beendet.“ Athanase verlässt eilig seinen Platz. Die Menge zerstreut sich schnell. Am nächsten Sonntag geht es weiter.
Wie in Kimisagara tagen einmal die Woche in jedem Dorf, in jedem Stadtteil in ganz Ruanda die Gacaca-Gerichte. Gacaca, zu deutsch „im Gras“, das waren früher die Treffen, bei denen die Ältesten unter einem Baum oder auf dem Dorfplatz zusammenkamen, um Streit über den Kaufpreis eines Kalbes oder um ein Stückchen Land zu schlichten. Heute sollen die Gras-Gerichte hunderttausendfach über Täter richten, die durch ihre Verbrechen gezeigt haben, wie böse der Mensch sein kann.
Zehntausende Täter leben unbehelligt in Freiheit
Die Laiengerichte gelten als einzige Möglichkeit, die Täter des Völkermords von 1994 abzuurteilen. Nachdem am 6. April 1994 das Flugzeug des Hutu-Präsidenten Juvenal Habyarimana in der Hauptstadt Kigali abstürzte – wahrscheinlich abgeschossen durch eine Rakete der Tutsi-Rebellen – forderten staatlich kontrollierte Radiostationen die Hutu-Bevölkerung auf, „alle Generationen der Kakerlaken auszumerzen“. 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurden ermordet, bis die Tutsi-Rebellen drei Monate später die Hauptstadt Kigali einnahmen. Heute hat gemessen an der Bevölkerung kein Land mehr Gefangene als Ruanda: In den Gefängnissen des Landes mit acht Millionen Einwohnern sitzen heute rund 120.000 Männer und Frauen, die an den Verbrechen beteiligt gewesen sein sollen und meist seit über zehn Jahren auf ihren Prozess warten. Viele weitere zehntausende Täter leben unbehelligt in Freiheit, weil sie bislang von niemand angeklagt wurden – weil Zeugen Angst vor ihnen haben oder weil es keine Zeugen ihrer Verbrechen gibt.
Einhundert Jahre würde es dauern, um die Gefangenen vor herkömmliche Gerichte zu bringen. Deshalb haben nun die insgesamt 12.000 Gacaca-Gerichte begonnen. Es gibt keine Staatsanwälte, keine Verteidigung, statt dessen neun Laienrichter, die einen Tag pro Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr, mit den Einwohnern zusammenkommen, um endlich die Verbrechen von damals zu untersuchen und zu sühnen. Innerhalb von drei Jahren sollen die Gras-Gerichte abgeschlossen sein, hofft die Gacaca-Behörde. Unabhängige Beobachter gehen von mindestens fünf Jahren aus.
„Ich bin Hutu und galt als Verräter“
Wir treffen Innenminister Christophe Bazivamo in seinem Büro in Kigali, ein Mann mit breitem Rücken und mächtigem Kopf. Er erzählt uns von dem Gacaca, in dem der Mord an seiner eigenen Familie verhandelt wurde. „1994 war ich Koordinator eines Projektes der deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit in Giciye in der Provinz Gisenye“, erzählt der Minister. „Ich bin Hutu und galt als Verräter, weil ich eine Tutsi geheiratet hatte und meine Mitarbeiter nach Qualifikation einstellte und nicht nach Stammeszugehörigkeit.“ Am 7. April 1994 belagerte die Hutu-Miliz Interahamwe, ein Haufen junger Männer mit Macheten, das Haus des deutschen Entwicklungsprojektes in Giciye. Der Mob vor dem Haus forderte die deutschen Entwicklungshelfer auf, Bazivamos Familie heraus zu geben. Die Entwicklungshelfer weigerten sich. Nach mehreren Stunden Verhandelns stürmte die Interahamwe, zu deutsch: „Die gemeinsam kämpfen“, das Haus und zerrte Bazivamos Familie ins Freie. Bazivamo war drei Autostunden südlich bei einem Seminar in Kigali, er verfolgte das Schicksal seiner Familie unter fürchterlichen Qualen über Funk. „Sie erschlugen meine Frau Eudosie, unser Neugeborenes Christian, meinen Erstgeborenen Alain, er war zwei Jahre und drei Monate alt, Marie, die achtjährige Schwester meiner Frau, und Jacqueline, das Hausmädchen.“
Knapp elf Jahre später, im März 2005, kamen dreitausend Menschen auf den Fußballplatz von Giciye, um zu sehen, wie Christophe Bazivamo mit den Mördern seiner Lieben abrechnen würde. Viele Zuschauer erwarteten seinen gerechten Zorn. „Ich kannte einige der Angeklagten persönlich. Einen von ihnen namens Anaclet Twibanire hatte ich in meinem Haus bewirtet – seine und meine Frau waren befreundet.“ Doch es geschah nicht, was die Menge erwartet hatte. Der Minister zerschmetterte seine Feinde nicht. „Als sie berichteten, wie meine Familie zu Tode kam – da weinte ich.“
Ein ruandischer Mann, ein Minister gar, der öffentlich weint: Wie revolutionär in einem Land, in dem Macht seit jeher auf demonstrierter Stärke und Gewalt beruhte! Wie unerhört in einer Gesellschaft, in der es als unmännlich und vor allem als unintelligent gilt, seine Gefühle zu zeigen! Die fünf Angeklagten baten den Minister um Verzeihung. „Ich vergebe euch“, sagte Bazivamo zu den Mördern. Den Zuschauern rief er zu: „Wir müssen vergeben, es ist unsere einzige Chance.“
„Ich fühle keinen Hass“, behauptet der Minister in seinem Büro. „Die Täter waren fehlgeleitet. Sie sind arm, ungebildet – und deshalb leicht zu manipulieren.“ Die Gacaca sollen Ruanda den Sprengstoff nehmen, erklärt Bazivamo, der die Gras-Gerichte mit aufgebaut hat. „Wir müssen als Hutu und Tutsi zusammenleben und Ruanda gemeinsam aufbauen.“ Uns Ausländern gegenüber nennt er die beiden Stämme beim Namen. Wenn man die Begriffe „Tutsi“ und „Hutu“ im Straßencafé verwendet, verstummt das Gespräch. Sie sind tabu, die Tutsi-dominierte Regierung hat verfügt, dass es nur noch „Ruander“ gibt.
Wer geständig ist, wird bevorzugt
Dass die angeblichen Anführer des Mobs die Morde bereuten, hat möglicherweise einen einfachen Grund: Wer geständig ist, dessen Fall wird bevorzugt behandelt und darf mit einem bedeutend milderen Urteil rechnen als ein Angeklagter. Die Richter verurteilten die Angeklagten zu Strafen zwischen sieben und 13 Jahren. Gefangene, die nicht gestehen, schmoren weiterhin im Gefängnis und werden ganz am Ende der Gacaca-Prozesse und damit erst in einigen Jahren abgeurteilt. Strafen von 25 bis 30 Jahre sind ihnen so gut wie sicher.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Praxis. Mit ihr lässt sich manche alte Rechnung begleichen – indem man jemanden fälschlicherweise anklagt; unabhängige Beobachter vermuten, dass bei jedem vierten Gefangenen die Anklagen unberechtigt sind. Deshalb ist in Ruanda nicht nur die Frage, welcher Täter lügt, sondern auch welcher Zeuge.
Für viele Verbrechen gibt es keine Zeugen, die Opfer sind tot. Deshalb ist es so entscheidend, dass die Täter gestehen. Dass sie daneben auch öffentlich bereuen, ist ebenfalls von größter Wichtigkeit. „Nur wenn ein Täter Reue zeigt, kann ein Opfer sich mit ihm versöhnen – und damit weiter mit ihm im Dorf, in der Nachbarschaft zusammenleben“, erklärt Christophe Bazivamo.
„Sind die Täter ehrlich, wenn sie um Vergebung bitten, Herr Minister?“ „Manche ja, andere nicht. Viele sind weiterhin gefährlich. Es bleibt viel zu tun, um das Denken der Menschen zu ändern.“
Kann Gacaca, diese Gruppentherapie für ein ganzes Land, wirklich funktionieren? Können die Ruander ihren Frieden finden? Wir fahren nach Giciye, um Anaclet Twibanire aufzusuchen, den ehemaligen Lehrer, der als einer der Mörder an Bazivamos Familie verurteilt wurde. Die Hügel sind steil wie Alpenmatten. Zuckerrohr, Süßkartoffeln, Bohnen ziehen sich in wohlbestellten Feldern hinauf. Barfüßige Männer und Frauen grüßen lächelnd auf den Serpentinenpfaden. Aus den über die Hügel gesprenkelten Hütten dringen die Geräusche eines friedlichen Alltags, Frauenlachen, Kindergeschrei, Ziegenmeckern. Twibanire ist aus dem Gefängnis entlassen worden, die zehn Jahre Haft vor der Verurteilung wurden ihm angerechnet. Wir steigen etwa 300 Höhenmeter zu seiner Hütte hinauf. Der Hausherr empfängt uns freundlich, wir sitzen im Innenhof auf Schemeln, im Koben nebenan quiekt ein Schwein. Twibanires alte Mutter und Fiston, der zehnjährige Sohn, stehen stumm in der Tür der Lehmhütte. Der Bergnebel hinterlässt feinste Tröpfchen auf Kleidung und Haut. „Ist es nicht zu nass für euch hier?“, fragt Twibanire besorgt.
„Ich habe niemanden verletzt oder getötet“
„Wie geht es Ihnen?“, fragen wir. Twibanire antwortet: „Es geht mir sehr gut. Ich habe meinen Sohn kennen gelernt. Und ich möchte wieder heiraten.“ ,“Ihre Frau hat Sie verlassen?“ „Ja, als ich im Gefängnis war.“ „Sind Sie ihr deshalb böse?“ „Nein, ich kann sie verstehen.“ „Warum waren Sie eingesperrt?“ „Mitgegangen, mitgefangen. Ich wollte meine Frau schützen, sie ist Tutsi, also musste ich mich mit der Interahamwe befreunden, damit man sie in Ruhe ließ. Deshalb bin ich mitgelaufen, als die Menge zum Haus der Deutschen ging. Und deshalb bin ich auch in den folgenden Wochen jeden Tag mit der Interahamwe unterwegs gewesen. Aber ich habe niemanden verletzt oder getötet.“
Twibanire spricht leise, seine Stimme ist angenehm.
„Als der Minister im Gacaca vor mir stand und weinte, habe ich mich dennoch schuldig gefühlt. Mir hat es gut getan, um Vergebung zu bitten, und ich rufe alle anderen auf, im Gacaca ihre Sünden zu gestehen! Sie helfen sich und anderen.“
Twibanire ist ein gut aussehender Mann Anfang vierzig mit offenem Blick, ein sympathischer Kerl, so empfinden wir ihn. Fiston, sein Sohn, hat keine Schuhe. Wir geben Twibanire ein paar Francs. Er freut sich sehr. Wir verabschieden uns herzlich.
Beim Abschied ins Tal meldet unsere Übersetzerin Fanny, 22, eine Tutsi aus einer wohlhabenden Familie in der Hauptstadt, bittere Zweifel an. „Der Kerl war wochenlang bei der Interahamwe und will nicht getötet haben?“, fragt sie kopfschüttelnd. „Die anderen hätten doch Verdacht geschöpft, hätten ihn als Verräter bezeichnet. Die haben aufgepasst, dass jeder mitmachte. Und selbst, wenn er nicht mit der Machete zugeschlagen hätte, hat er zumindest geholfen, Opfer aufzuspüren.“ Die Gruppe, in der sich Twibanire aufhielt, soll 200 Menschen auf dem Gewissen haben. „Der Mann sprach von Reue, aber seine Augen sagten mir, dass er log. Oh, ich war voller Wut bei dem Gespräch!“
„Wirklich? Das habe ich nicht bemerkt.“
„Ich musste ja freundlich zu ihm sein, sonst hätte er ja nichts erzählt. Wir Ruander sind gut darin, unsere Gefühle zu verbergen.“
Vor den Gacaca-Gerichten gestehen in der Regel nur Menschen wie Twibanire, die in jahrelanger Haft weich gekocht wurden. „Die Gefangenen bekommen in den ersten Jahren Prügel als tägliche Medizin“, sagt Fanny ungerührt. Täter, die noch frei herumlaufen, versuchen gewöhnlich, ihre Taten zu leugnen – aus Scham oder Kalkül. In Kigali kursieren Gerüchte von Geheimbünden, in denen sich Täter gegenseitig geloben, den anderen nicht zu belasten.
Lehrerin Marie Claudine Kwantege, 32, die ehemalige Frau Twibanires, wohnt in einem winzigen Haus an der Hauptstraße im Tal. Eudosie, die ermordete Frau von Christophe Bazivamo, war ihre Kollegin und beste Freundin. Sie wirkt schüchtern. Eine vergilbte Weltkarte hängt an der Wand.
„Marie Claudine, welche Länder würden Sie gerne besuchen?“
„Ach, die Karte hängt da ohne Grund. Ich wünsche mich nirgendwo hin. Der Wunsch würde sowieso nicht wahr werden.“
„Wir waren bei Ihrem Ex-Mann. Er sagt, er sei bei der Interahamwe gewesen, um Sie zu beschützen.“
„Die Strafe war genau richtig“
„Das glaube ich ihm nicht. Er war jeden Tag von morgens früh bis spät abends weg. Ich habe mich den ganzen Tag bei einem Nachbarn auf der Toilette versteckt und hatte furchtbare Angst. Wenn er nachts zurückkam, fragte ich ihn: ‚Was geschieht im Tal?‘ Er antwortete nicht, legte sich hin und schlief ein. Verhält sich so ein Mann, der seine Frau beschützen will?“
„Er war zehn Jahre im Gefängnis. War die Strafe zu hart oder zu mild?“
„Sie war genau richtig. Wie sollte ich etwas anderes sagen, als das, was das Gericht für richtig befunden hat?“
Sich klein machen, möglichst unwichtig sein, sich der Obrigkeit anschließen, das scheint in Ruanda, in dem Jahrhunderte lang die Tutsi die Hutu knechteten, dann die Hutu die Tutsi dominierten und seit Juli 1994 die Tutsi das Sagen haben, eine Überlebensstrategie: Wer sich in seinem Dorf in irgend einer Weise hervor hob, lief Gefahr, zuerst ermordet zu werden.
Marie Claudine Kwantege sieht ihren Ex-Mann mindestens einmal die Woche – im Gacaca. Hinzugehen ist für die Einwohner Pflicht. Er wird manchmal als Zeuge aufgerufen und sie ist „Gacaca-Beauftragte“. Sie beobachtet die Verhandlungen und berichtet der Gacaca-Behörde – so behält die Regierung in Kigali die Kontrolle über die Dorfgerichte bis in den hintersten Winkel des Landes.
„Marie Claudine, Ihr Ex-Mann hat im Gacaca um Vergebung gebeten. Verzeihen Sie ihm?“
„Ich habe kein Problem mit diesem Mann. Wir reden miteinander, er darf unsere Tochter sehen.“
„Was ist mit Fiston, dem Sohn?“
„Fiston ist nicht von mir. Er ist der Sohn meiner Schwester, gezeugt in den Tagen, in denen ich mich in der Toilette versteckte.“
Wir fahren zurück nach Kigali. „Wahrscheinlich kam Twibanire zu der Hütte der Schwester und verlangte Sex“, sagt Fanny. „Natürlich schlief sie mit ihrem Schwager. Sie ist Tutsi – jeder konnte sie töten. Sie hoffte, dass er sie beschützen würde, wenn sie ihm zu Willen war.“ Vor dem Wagenfenster tauchen üppig begrünte Hänge auf, sie werden gequert von Pfaden, auf denen sich Hunderte von Menschen im Gänsemarsch mühen, alle in rosafarbenen Hemden und Hosen – es sind „Flamingos“, also Gefangene. Alle tragen einen gelben Kanister mit Wasser auf dem Kopf. Das Bild taugt als Symbol für das fruchtbare Land, in dem alle gut leben könnten, wenn sie nicht Gefangene ihrer Vergangenheit wären und nicht schwere Last schleppen müssten.
Ein deutscher Pater versteckte rund 200 Menschen
Zurück in Kigali besuchen wir Otto Mayer, 58, ein deutscher Pater vom Orden der „Weißen Väter“. Während des Genozids 1994 versteckte er rund 200 Menschen unter höchster Gefahr für sein eigenes Leben in den Häusern seiner Pfarrei. Die meisten Flüchtlinge wurden kurz vor Einmarsch der Rebellen entdeckt und ermordet, Mayer selbst von einer Granate schwer verwundet. Wir begleiten den ihn in eine Grundschulklasse zum Gottesdienst. 130 Kinder hängen an seinen Lippen. Wenn er eine Frage stellt, schnippen Dutzende mit den Fingern. In den Fürbitten betet Mayer für die Malariakranken und für das Gelingen der Gacaca. „Man muss die Wahrheit sagen!“, predigt Mayer. „Ihr kennt das Sprichwort: ´Die Wahrheit geht durchs Feuer, ohne sich zu verbrennen´!“ In der Klasse sind ein Drittel der Kinder Halb- oder Vollwaisen. Neben den Kindern von Opfern sitzen Kinder von Tätern, die sich als neue Opfer sehen und die Gacaca als Sieger-Justiz betrachten.
„Herr Mayer, ist es möglich, dass sich ein Mensch mit den Mördern seiner Familie versöhnt?
„Es ist unheimlich schwer. Eine Frau sagte mir: ´Am Morgen bin ich überzeugt, dass ich verziehen habe, und am Abend möchte ich den Tätern wünschen, dass sie am Durchfall krepieren´. Aber wenn ein Täter im Gacaca die Wahrheit sagt und ehrlich bereut, hilft das den Angehörigen der Opfer.“
„Gibt es für die Ruander auch einen anderen Weg als das Verzeihen?“
„Natürlich. Den Hass. Aber wer hasst, der findet keinen Frieden. Er wird krank – oder er explodiert irgendwann.“
„Und mit ihm erneut das Land?“
„Entscheidend ist, wie sich die Menschen erinnern. Mit dem Wunsch nach Versöhnung – oder mit dem Gedanken an Rache. Die Versöhnung wird Jahrzehnte dauern. Die Kinder haben keine eigene Erinnerung an die Verbrechen. Das ist eine Chance.“
Ein bisschen klingt es so, als wolle sich der Pater selbst Mut machen.
„Warum sind alle so still?“
Fanny lädt uns zum Abendessen ein. Die Familie ist im Wohnzimmer versammelt. Fannys Angehörige sprechen kaum. Wir, die Gäste, machen die Konversation. Loben das Huhn, die Kochbananen, schwärmen von der Schönheit der ruandischen Landschaft, monologisieren über die kommende Fußball-WM. Als uns nichts mehr einfällt, herrscht Schweigen. Alle starren in den Fernseher, irgendein afrikanisches Match, der Ton ist abgedreht. „Warum sind alle so still?“, fragt Fanny.
Später, draußen im Garten, erzählt Fanny die Geschichte ihrer Familie. Im April 1994 war sie, damals elf Jahre alt, mit ihrer Mutter in Nairobi – der Vater wollte mit den älteren Geschwistern nachkommen, wenn es in Kigali zu gefährlich werden sollte, wo er als Ingenieur arbeitete. Einen Tag nach Absturz des Flugzeugs tauchte Interahamwe am Tor des Familiengrundstücks auf. „Flieht!“, sagte der Vater zu seinen drei anwesenden Kindern. „Wir bleiben bei dir!“, sagten sie. „Ich bitte euch: Flieht!“ Die Geschwister sprangen über die Hintertür aus dem Haus. „Papa versuchte die Interahamwe in ein Gespräch zu verwickeln, damit meine Geschwister einen Vorsprung bekämen. Sie zerhackten ihn mit Macheten. Einige Stunden später schlich mein ältester Bruder zurück, er fand Papa im Wohnzimmer, er lebte noch. Papa sagte: ´Geh, ich schaffe es nicht.“
Der Vater konnte dem Sohn noch sagen, wo er Geld versteckt hatte. Mit diesem Geld gelang es dem Bruder, sich und die Geschwister außer Landes in Sicherheit zu bringen.
„Tja, mein Vater ist ein Held.“
„Wart ihr euch sehr nahe, Fanny?“
„Nicht so sehr. Ich war ja schon einige Jahre in Nairobi, als er starb. Aber er hat mich geliebt. Er hat mich verwöhnt und verzogen. Und hier ist er begraben.“
Fanny zeigt zu Boden, ein Stück Garten, bewachsen mit Gras und Büschen. Nichts deutet auf ein Grab.
„Den Stein mussten wir entfernen – die Regierung hat private Gräber verboten, alle Genozid-Opfer sollen in Gedenkstätten umgebettet werden.“
Ob Fanny die Wahrheit sagt? Stehen wir wirklich an einem Grab? Es wirkt unwirklich. Irgendwann beginnt man an allen und allem zu zweifeln in diesem Land, in dem es überlebenswichtig ist, andere und wohl auch sich selbst anzulügen, weil die Wahrheit unerträglich ist.
Einer von Fannys Brüdern hatte sich den Tutsi-Rebellen angeschlossen. „Neulich hab ich ihn gefragt, ob er bedauert, was er im Krieg gemacht hat“, erzählt Fanny. Der Bruder antwortete: „Einmal bin ich dazugekommen, als eine Frau Kleinkinder mit dem Kopf gegen eine Mauer schlug. Als sie mich gesehen hat, flehte sie: ´Töte mich nicht!´ Ich dachte: Eine Kugel ist zu gut für dich, du solltest lange leiden müssen. Dann habe ich abgedrückt. Heute tut mir das leid. Ich träume oft von der Frau.“
Die Kriegsverbrechen der Tutsi-Rebellen werden nicht verfolgt
Der Bruder kann diese Episode ohne Angst vor der Justiz erzählen. Die Kriegsverbrechen der Tutsi-Rebellen werden nicht verfolgt. Hutus erzählen, dass die Tutsi-Regierung noch Ende der Neunzigerjahre Rache genommen und Missliebige des anderen Stammes heimlich liquidiert hätte.
Fanny glaubt dem Bruder seine Geschichte – doch es unwahrscheinlich ist, dass sie sich so zugetragen hat. Die meisten Massaker wurden gemeinschaftlich verübt. Wie kam eine einzelne Hutu-Frau dazu, allein mit vielen Tutsi-Babies zu sein? Warum war Fannys Bruder als Soldat ebenfalls allein? Warum der Bruder die Geschichte so erzählt – das weiß nur er selbst.
Nicht zu leugnen sind auf jeden Fall die Kerben in der Badewanne in Fannys Elternhaus, Spuren der Handgranaten, die die Mörder in die Zimmer warfen. Wahr ist wohl auch, was Fanny über ihren ältesten Bruder erzählt, der den sterbenden Vater fand. „Immer Anfang April, wenn es auf die Gedenktage zugeht, ist mein Bruder nicht ansprechbar, weint die ganze Zeit. Lange haben wir über das Jahr 1994 überhaupt nicht geredet. Meine Mutter sagt, sie sei nicht stark genug.“
Fanny geht ins Haus, kommt zurück mit einem Album, darin Fotos, nach dem Sieg der Tutsi-Rebellen aufgenommen. Zu sehen ist das Haus, ein katholischer Priester an der Stelle, an der wir gerade stehen, aufgeworfene Erde, ein Sarg, die Mutter in einem feinen Kleid, die Brüder in Sakkos. Fanny klappt das Album zu.
„All diese ehemaligen Interahamwe-Leute, sie teilen das Leben mit uns. Die Menschen, die sie ermordeten, hätten auch gerne gesehen, wie ihre Kinder aufwachsen. Es ist so unfair!“
„Bringen die Gacaca-Gerichte wenigstens ein Stück Gerechtigkeit?“
„Ja. Wenn auch die Täter nicht ehrlich bereuen und gestehen, dann haben doch die Opfer den Mut, zum ersten Mal zu sprechen.“
„Und was ist mit dem zweiten Ziel, der Versöhnung?“
„Ich muss vergeben. Ich muss mich auf das konzentrieren, was heute ist. Mein Vater ist tot. Nichts wird ihn zurück bringen.“
Im Garten stolziert ein Pfau. „Früher hatten wir fünf. Sie sind wunderschön, nicht? Jetzt haben wir leider nur noch zwei. Schuld daran ist unser Wachhund.“ Wenn der Hund am Tor Menschen wittert, springt er bellend von der Veranda herunter und durch den Garten. Das erschreckt die Vögel so, dass sie in Panik wegrennen. „Dabei haben sich nacheinander drei der Pfauen ein Bein gebrochen. Wir mussten sie töten. Dumme Tiere!“, sagt Fanny und lächelt. Ihr Lächeln sieht herzlich aus und unbeschwert.

